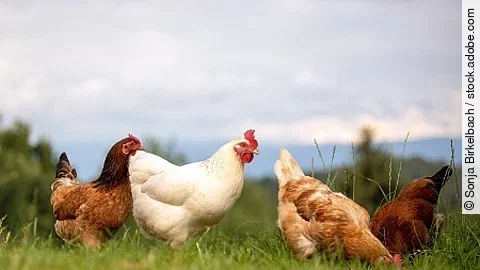Inhalt

Das Huhn ist beliebt
Das Huhn erfreut sich besonders in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit als „neues Heimtier“ [1]. Somit werden den niedergelassenen Tierärzt*innen immer häufiger Hobbyhühner als Patienten vorgestellt. Hierbei handelt es sich vorrangig um Liebhabertiere von Privatpersonen aus Kleinsthaltungen, Gnadenhöfen oder sozialen Einrichtungen, nicht zu vergleichen mit Wirtschaftsgeflügelhaltungen [1]. Einige dieser Halter*innen schaffen sich Hühner mit der Annahme an, dass diese anspruchslose und sehr einfach zu haltende Tiere seien, und haben daher wenig bis gar keine Vorkenntnisse zur Haltung und Fütterung von Hühnern [1].
Da Hühner als lebensmittelliefernde Tiere klassifiziert sind, gibt es bei der Haltung und tierärztlichen Betreuung von Hühnern jedoch einige Punkte zu beachten:
- Anzeigepflicht der Haltung beim zuständigen Amt (§ 26 ViehVerkV, § 2 GeflPestSchV) und Meldung bei der Tierseuchenkasse,
- Impfpflicht gegen die Newcastle-Krankheit (atypische Geflügelpest, GeflPestV),
- gesetzliche Vorgaben zur Anwendung und Abgabe von Medikamenten.
Darüber hinaus spielen beim Huhn diverse Infektionserkrankungen eine Rolle, die teils einer Melde-, Mitteilungs- oder Anzeigepflicht unterliegen sowie zoonotisches Potenzial besitzen können.

Problemkreis Atemwege
Erkrankungen des Respirationstrakts stellen bei Hühnern ein häufig auftretendes Problem dar. Durch ihren besonders aufgebauten Atmungsapparat, der sich unter anderem durch relativ kleine und volumenkonstante Lungen mit Parabronchien sowie Luftsäcke auszeichnet, wird ein schneller und effektiver Gasaustausch ermöglicht [2]. Aufgrund dessen sind Vögel deutlich empfindlicher für inhalative Toxine und Infektionen des Respirationstrakts als Säugetiere [3]. Bei Hühnern handelt es sich seltener um eine Einzeltiererkrankung, häufig ist der gesamte Bestand betroffen und meistens spielen infektiöse Erreger eine entscheidende Rolle. Managementfehler und ungünstige Haltungsbedingungen begünstigen die Infektionen und insbesondere die Krankheitsentstehung [4].
Anamnese
„Meine Hühner haben Schnupfen“ – so lautet häufig der Vorbericht von Besitzer*innen, die ihre Hühner in der Praxis vorstellen und hier ist eine ausführliche Anamnese besonders wichtig. Beim Signalement von Hühnern sollte neben den üblichen Informationen auch die „Nutzungsart“ (z. B. Eilieferant, reines Liebhabertier, Rassegeflügel für Zucht und Ausstellung) erfragt werden. Des Weiteren ist die Bestandsgröße wichtig sowie mögliche Kontakttierarten, die Herkunft der Tiere und seit wann diese im Besitz sind. Zudem sollte man erfragen, ob und wann neue Tiere in den Bestand aufgenommen wurden, ob Vorerkrankungen bekannt und bereits Behandlungen erfolgt sind.
Die Einschätzung, ob es sich um eine Einzeltiererkrankung oder ein Bestandsproblem handelt, spielt eine Rolle bei der späteren Entscheidung, ob nur das vorgestellte Einzeltier oder der gesamte Bestand zu behandeln ist. Exakte Angaben zur Haltung (z. B. Stallart, Auslauf, Einstreu) sowie zu Futter und Nahrungsergänzungsmitteln sind ebenfalls einzuholen und können gegebenenfalls erste Hinweise auf Managementfehler geben.
MERKE
Bei der Anamnese sollten unbedingt die Legetätigkeit, die Anzahl erkrankter und verstorbener Tiere im Bestand sowie auf jeden Fall auch der Impfstatus erfragt werden (Bescheinigung vom Aufzüchter) [5]. Erstere sind für die Einschätzung bezüglich bestimmter Infektionserkrankungen von Bedeutung (z. B. Geflügelpest, Newcastle-Krankheit).
Klinik
Neben einer klinischen Allgemeinuntersuchung des gefiederten Patienten sollte bei der Adspektion besonderes Augenmerk auf Symmetrien im Kopfbereich, bei den Augen und Nasenlöchern, in der Schnabelhöhle und Trachealöffnung sowie bei Körperhaltung und Atmung gelegt werden. Lungen und Trachea können auf Atemgeräusche und deren Lokalisation auskultiert werden. Im Gegensatz zu Kleintieren zeigen Hühner in der Regel eine sehr unspezifische Symptomatik, die wenig Aufschluss über die zugrunde liegende Ursache verrät, wie z. B.:
- gesträubtes Gefieder („Plustern“),
- hängende Flügel, hängende Schwanzfedern,
- halb oder vollständig geschlossene Augenlider [Abb. 1],

- Apathie, vermehrtes Liegen,
- verminderte Futter- und Wasseraufnahme,
- verminderte Legeleistung.
Bei Hühnern mit Erkrankung der Atemwege treten zusätzlich zu den eher unspezifischen Krankheitssymptomen auch Symptome auf, die deutliche Hinweise auf eine Erkrankung des Respirationstraktes geben [7]:
- Schnupfen, Niesen, Nasenausfluss,
- Atemgeräusche, z. B. gurgelnd, röchelnd,
- Schnabelatmung [Abb. 2],

- Schwellungen um das Auge, sog. „Eulenkopf“ [Abb. 3],

- Kloakenatmung (atemsynchrones Einziehen und Hervortreten der Kloake),
- Bläuliche Verfärbung der Kopfanhänge,
- Pinguinhaltung (Aufrichten und Längsstreckung des Körpers, Halsstreckung, ggf. Abstellen der Flügel).
MERKE
Ein Huhn, welches ohne erkennbare Ursache (z. B. starke Hitze, Stress) anhaltend Schnabelatmung zeigt, leidet unter Dyspnoe und ist als Notfall einzustufen.
INFO
Einige Erkrankungen lösen beim Huhn indirekt Symptome wie Atemnot oder Schnabelatmung aus und werden dadurch oft fälschlicherweise dem Respirationstrakt zugeordnet. Aufgrund des Fehlens von Schweißdrüsen bei Vögeln regulieren Hühner ihre Wärmeabgabe unter anderem über die Atmung. Bei Hitzestress kommt es so zur Erhöhung der Atemfrequenz und gegebenenfalls zur Schnabelatmung. Weiterhin können raumfordernde Prozesse im Körper, wie Aszites oder Schichteier (Ansammlungen von Fibrin und Entzündungszellprodukten im Zuge einer chronischen Salpingitis), durch Verdrängung der Luftsäcke zu Atemnot führen [1], [4].

Ursachen
Im Folgenden wird sich auf die am häufigsten bei Hobbygeflügelhaltungen vorkommenden Erkrankungen der Atemwege beschränkt.
Mykoplasmen
Es gibt eine Vielzahl an Mycoplasma-Arten, die Geflügel infizieren können [8]. Für Hühner gelten M. gallisepticum (MG) und M. synoviae (MS) als pathogen, andere Arten werden als Kommensalen angesehen [7]. Mykoplasmen besitzen keine Zellwand, weshalb komplexe Kulturmedien zur Anzucht benötigt werden und Beta-Laktam-Antibiotika sowie Cephalosporine wirkungslos sind. In der Hobbyhaltung sind sie vor allem wichtige Primärerreger, die den Weg für Sekundärerreger ebnen [7]. Als prädisponierende Faktoren spielen mangelnde Haltungs- und Fütterungsbedingungen eine Rolle. Die Übertragung findet horizontal aerogen, vorwiegend über direkten Kontakt mit erkrankten oder latent infizierten Tieren, aber auch über Wildvögel statt. In der Anamnese wird hier häufig über einen kürzlich erfolgten Zukauf oder Ausstellungsbesuch berichtet [8]. Darüber hinaus können MG und MS vertikal über das Ei übertragen werden. Den Besitzer*innen sollte daher von der Zucht mit Tieren aus einem positiven Bestand (auch strikte Kunstbrut) abgeraten werden.
Mycoplasma gallisepticum
MG ist der Erreger der Chronic respiratory disease (CRE), auch Infektiöse Sinusitis genannt. Das Auftreten einer klinisch apparenten Infektion ist abhängig vom Immunstatus, der Anzahl der Mykoplasmen, der Virulenz und zusätzlichen Faktoren wie dem Staubgehalt in der Luft. Die Inkubationszeit beträgt 6 – 21 Tage. Die Morbidität ist in der Regel hoch und die Mortalität sehr variabel, je nach Alter und Sekundärinfektionen der betroffenen Tiere. Es kommt zu einer katarrhalischen Entzündung des oberen bis mittleren Respirationstraktes. Symptome können eine ein- oder beidseitige Schwellung des Sinus infraorbitalis [Abb. 4] sowie Dyspnoe, Niesen, ein krächzendes Atemgeräusch, Augen- und Nasenausfluss, zunehmende Apathie und erhöhtes Wärmebedürfnis sein. In der pathologisch-anatomischen Untersuchung (Sektion) ist eine katarrhalische Entzündung erkennbar, bei schwereren Verläufen treten Bronchopneumonie, adhäsive fibrinöse Aerosacculitis und Serositis auf [Abb. 5] [6].


Mycoplasma synoviae
M. synoviae kann neben Erkrankungen der Atmungsorgane zu Infektionen der Gelenke und des Reproduktionstrakts führen. Es treten Bursitis und fibrinöse Arthritis sowie Salpingitis mit Polkappendefekten am Ei auf. Die Inkubationszeit beträgt 20 – 21 Tage und die klinische Symptomatik sowie die pathologisch-anatomischen Veränderungen der respiratorischen Form entsprechen der Symptomatik von MG, allerdings in abgeschwächter Form. Die Morbidität schwankt zwischen 2 und 75%, die Mortalität ist niedrig (bis 1%). Legehennen sind häufig latent infiziert und somit symptomlos, stellen aber eine Infektionsquelle für andere Hühner dar [6].
MERKE
Bei einem Bestand, in dem viele Tiere Atemwegssymptome zeigen, aber kaum Todesfälle auftreten, immer auch an Mykoplasmen denken!
Der direkte Nachweis von Mykoplasmen kann durch die Anzucht auf speziellen Nährböden über mind. 3 Wochen erfolgen. Die PCR (polymerase chain reaction) wird als deutlich schnellere Methode vorrangig eingesetzt [7]. Hierbei muss beachtet werden, dass bei Hühnern auch kommensale Mykoplasmen vorkommen und daher nur eine spezifische PCR auf MG bzw. MS ein aussagekräftiges Ergebnis erbringt (Tab. 1).
| Erreger | Probenmaterial | Untersuchungsmethode | |
| bakteriell | Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida, E.coli, Bordetella avium, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Avibacterium paragallinarum*#, Gallibacterium anatis,* Erysipelothrix rhusiopathiae* | Tracheal- oder Choanentupfer | bakterielle Anzucht |
| Mykoplasmen | Trachealtupfer | Anzucht (mind. 3 Wochen) PCR auf MG, MS | |
| Serum | Serumschnellagglutination, ELISA | ||
| Chlamydia spp. | Dreifachtupfer (Konjunktiven, Rachen, Kloake) | PCR | |
| viral | infektiöse Bronchitis | Tracheal-, Kloakentupfer | PCR wenn geimpft: IB-Variantenbestimmung |
| AIV ND | Rachen-, Kloakentupfer | PCR | |
| ILT | Trachealtupfer | PCR | |
| aviäre Metapneumoviren (TRT, SHS) | Trachealtupfer | PCR | |
| parasitär | Syngamus trachea | Kotprobe | Flotationsverfahren |
| mykotisch | Aspergillus sp., Mucor sp. | Luftsacktupfer | mykologische Anzucht |
Coryza contagiosa
Der Ansteckende Hühnerschnupfen, Coryza contagiosa (CC), ist eine akute, hochansteckende Erkrankung des Respirationstraktes von Hühnern und wird durch Avibacterium paragallinarum verursacht. Das gram-negative Stäbchenbakterium gehört zur Klasse der Pasteurellaceae. Hühner sind Hauptwirte und die Übertragung findet horizontal, hauptsächlich über direkten Kontakt und das Trinkwasser, statt. Als Hauptüberträger gelten ältere, latent oder chronisch infizierte Hühner. Es kommt zu einer sehr hohen Morbidität (bis 90%) mit niedriger Mortalität. Dennoch können schwere Verläufe unter Einbeziehung weiterer Organsysteme durch Sekundärinfektionen oder Doppelinfektionen auftreten.
Der Erreger löst aufgrund seiner Affinität zum Zilienepithel des oberen Respirationstrakts Schnupfen, Sinusitis, Nasen- und Augenausfluss aus, außerdem kommt es zu einem Legeleistungsabfall. Es treten Ödeme des Kopfes und der Kopfanhänge infolge einer akuten katarrhalischen Entzündung der Sinus infraorbitales auf, welche im Verlauf fibrinös werden kann (käsiges Material) [Abb. 6]. In Kombination mit Sekundärinfektionen können eine Bronchopneumonie und fibrinöse Aerosacculitis sowie septikämische Verläufe ausgelöst werden [Abb. 5]. Die kulturelle Anzucht aus Tupfer- oder Organproben sollte zusätzlich unter mikroaerophilen Bedingungen erfolgen. Hierbei ist ein NAD-produzierender Ammenkeim (z. B. Staphylococcus epidermidis) erforderlich [6].

INFO
Auswahl der wichtigsten Ursachen für Atemwegserkrankungen beim Huhn [6]
1.) infektiöse Ursachen:
bakteriell
- Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae
- Pasteurella multocida (Geflügelcholera)
- Avibacterium paragallinarum (Ansteckender Hühnerschnupfen, Coryza contagiosa)
- Gallibacterium anatis
- Ornithobacterium rhinotracheale (ORT)
- Erysipelothrix rhusiopathiae (Rotlauf)
- E. coli
- Bordetella avium
- Klebsiella spp.
- Chlamydia psittaci (Chlamydiose)
- Mycobacterium avium (Aviäre Tuberkulose)
viral
- Aviäre Influenza (AIV)
- Newcastle Disease (ND)
- Infektiöse Bronchitis (IB)
- Infektiöse Laryngotracheitis (ILT)
- Aviäre Metapneumoviren (TRT, SHS)
parasitär
- Syngamus trachea
- Cryptosporidium spp.
mykotisch
- Aspergillus spp. (Aspergillose)
2.) nicht-infektiöse Ursachen:
- hoher Schadgasgehalt
- niedrige Luftrate
- hohe oder niedrige Luftfeuchtigkeit
- hohe oder niedrige Temperatur
- hoher Staubgehalt
- Vitamin-A-Mangel
Aviäre Pasteurellose
Die aviäre Pasteurellose oder Geflügelcholera wird durch das gram-negative Stäbchenbakterium Pasteurella multocida ausgelöst. Die Übertragung findet horizontal über direkten und indirekten Kontakt, vor allem über Wildvögel, Säuger und latent infizierte Hühner statt. Es wird beschrieben, dass Tiere unter 16 Wochen relativ resistent zu sein scheinen und eine saisonale Häufung der Erkrankung im Herbst und Winter auftritt. Der Erreger dringt hauptsächlich aerogen ein, aber auch über Hautwunden (z. B. Katzen-, Rattenbiss). Bei hochvirulenten Stämmen treten perakute Todesfälle mit einer hohen Morbidität (50 – 90%) und Mortalität (bis 80%) auf [6].
Die Tiere sterben hier meist ohne vorherige klinische Symptomatik. Bei einer akuten Infektion sind unspezifische Krankheitsanzeichen sowie zyanotische Veränderungen der Kopfanhänge zu beobachten. Exsudative Konjunktivitis und Sinusitis, rasselnde Atemgeräusche mit Dyspnoe, Schwellungen der Infraorbitalsinus [Abb. 4], der Kehllappen, der Sohlenballen und der Bursa sternalis sowie Torticollis sind Symptome einer chronischen Erkrankung, welche auf eine akute Erkrankung folgen kann oder durch niedrig virulente Stämme ausgelöst wird. In der Sektion sind bei einem akut septikämischen Verlauf vorrangig Einblutungen und Organnekrosen sowie hyperämische und ödematöse Schleimhäute zu finden. Bei einer chronischen Erkrankung kann eine adhäsiv-fibrinöse Aerosacculitis festgestellt werden [Abb. 5]. Klassischerweise erfolgt der Erregernachweis mittels Anzucht [9].
Infektiöse Laryngotracheitis
Die Infektiöse Laryngotracheitis (ILT) wird durch das Gallid Herpesvirus 1 verursacht und die unterschiedliche Virulenz von ILT-Stämmen kann zu milden und schweren Verläufen führen. Das Virus vermehrt sich vor allem im Epithel von Larynx und Trachea, es kommt zur Ausbreitung und Latenz in den Trigeminusganglien. Reaktivierungen durch Stress sind während der langen Viruspersistenz (> 15 Monate) möglich [6]. Meist kommt es zur direkten Übertragung durch Aerosole von mit Feldvirus infizierten Hühnern (aber auch anderen Vogelarten) oder geimpften Tieren (Lebendvakzine) beim Zusammensetzen geimpfter und ungeimpfter Tiere. Eine indirekte Übertragung ist ebenfalls möglich.
Klinisch ist eine hohe Mortalität, ca. 7 – 10 Tage nach einem Neuzugang oder einem Ausstellungsbesuch, als erstes Anzeichen festzustellen. Die Mortalität kann bei hoch virulenten Stämmen sehr schnell ansteigen, ohne vorherige Symptome (bis 50%). Vor allem Junghennen im ersten Lebensjahr sind besonders empfänglich. Die Tiere zeigen Kopfschütteln mit blutigem Sekret im Schnabel und Pinguinhaltung infolge einer hochgradigen inspiratorischen Dyspnoe mit klagenden Atemgeräuschen. Der Tod tritt als Erstickungstod ein. Das Auffinden von blutig-fibrinösem Schleim in Larynx und Trachea gilt als pathognomonisch für die Erkrankung. Es treten auch Konjunktivitiden auf, die bei milden Verläufen als alleiniges Symptom festgestellt werden können [6], [9]. In der Sektion sind neben katarrhalisch bis blutig-fibrinösen Läsionen in Sinus, Larynx und der Trachea teils auch Pneumonien und eine hämorrhagische Kloakenentzündung (pathognomonisch) zu sehen [Abb. 7] [6].


MERKE
Beim Auftreten von Todesfällen im Bestand, inspiratorischer Dyspnoe mit blutigem Schleim in den oberen Atemwegen, blutiger Kloakenentzündung und Pinguinhaltung immer an ILT denken!
Notimpfung möglich
Eine Verdachtsdiagnose kann bereits anhand der Klinik und des Vorberichts gestellt werden. Bei ungeimpften Tieren ist der PCR-Nachweis von Trachealtupfern oder Organproben das Mittel der Wahl. Bei vorberichtlich bereits geimpften Tieren muss beim Nachweis auf die Differenzierung von Feld- und Impfstämmen geachtet werden. Bei nachgewiesener Infektion ist eine Notimpfung möglich, diese sollte so früh wie möglich nach Ausbruch erfolgen und ist als Einzeltierimpfung (Augentropfen) durchzuführen. Wichtig ist zu beachten, dass mit Lebendvakzinen geimpfte Tiere zu latenten Trägern werden können und nicht mit ungeimpften Tieren zusammengebracht werden sollten [6], [9]. Und nicht vergessen: Es handelt sich bei der Erkrankung um eine meldepflichtige Tierkrankheit (TKrMeldpflV)!
Infektiöse Bronchitis
Die Infektiöse Bronchitis (IB) wird durch ein Coronavirus übertragen. Es gibt zahlreiche, antigenetisch unterschiedliche Stämme und es entstehen regelmäßig neue Varianten. Die Übertragung findet aerogen statt und durch seine hohe Kontagiösität breitet sich das Virus schnell aus. Die Inkubationszeit ist mit 16 – 36 Stunden sehr kurz und es kommt zu einer intermittierenden und langen Ausscheidung des Erregers über Nasensekret und Kot. Eine Infektion findet immer über den Respirationstrakt statt, Läsionen können allerdings auch in der Niere, dem Reproduktionstrakt und Verdauungstrakt auftreten, wobei es hierbei deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Virusstämmen gibt. Durch eine Infektion entstehen Epithelschäden, welche Sekundärinfektionen begünstigen. Bakterielle Septikämien mit Fibrinablagerungen in der Körperhöhle sind die Folge. Klinisch zeigt sich eine altersabhängige Symptomatik.
Die höchste Morbidität (bis 30%) und klassische Respirationssymptome treten vorrangig bei Jungtieren auf, Legehennen fallen vorrangig durch Legeleistungsabfall (um bis zu 50%) auf [6]. Bei Letzteren werden darüber hinaus auch typische Eischalendeformationen festgestellt. Je älter die Tiere sind, desto weniger ausgeprägt sind die klinischen Anzeichen. Bei einer frühen Infektion (2. Lebenswoche) können in Folge Eileiterdefekte und -zysten auftreten, die zu einer ausbleibenden Legetätigkeit führen (sog. „falsche Leger“). Für die Diagnose mittels PCR werden Trachealtupfer und später im Krankheitsverlauf auch Kloakentupfer verwendet. Gruppenspezifische PCR, die verschiedene Stämme enthalten, sind hier von Vorteil. Nach einem Nachweis im Bestand sollten zukünftige Herden gegen die nachgewiesene Variante geimpft werden [6], [9].
Aviäre Influenza & Newcastle Disease
Beim Auftreten von Atemwegssymptomen muss immer auch an Aviäre Influenza (AI, Geflügelpest) und Newcastle Disease (ND, Atypische Geflügelpest) gedacht werden. Bei der AI muss zwischen einer Infektion mit hoch virulenten Viren (highly-pathogenic avian influenza virus, HPAIV, klassische Geflügelpest) und niedrig virulenten Viren (low-pathogenic avian influenza virus, LPAIV) unterschieden werden. Klinisch lassen sich HPAIV und ND nicht unterscheiden.
Bei beiden spielen Wildvögel, vor allem Wassergeflügel, als Reservoir und Überträger eine große Rolle. Die Übertragung findet vorrangig horizontal über Kot und Sekrete, aerogen und über unbelebte Vektoren statt [6]. Bei einer Infektion mit HPAIV kommt es zu einem plötzlichen Abfall von Futteraufnahme und Legeleistung mit einer Mortalität von bis zu 100% innerhalb von 72 Stunden. Neben respiratorischen Symptomen kommt es zu zentralnervösen Störungen, dünnschaligen Eiern, Zyanosen der Kopfanhänge und Einblutungen [6], [7]. Bei ND wird ebenfalls eine Morbidität und Mortalität von bis zu 100% bei einer Inkubationszeit von 4 – 25 Tagen beobachtet. Die klinische Symptomatik variiert je nach Virusstamm mit respiratorischen Symptomen, grünlicher Diarrhoe, katarrhalischen Entzündungen, ZNS-Symptomen, Einbruch der Legeleistung und dünnschaligen Eiern [6]. Im Gegensatz zu HPAIV und ND wird bei einer Infektion mit LPAIV eine niedrige Mortalität bei hoher Morbidität festgestellt. Es treten eher unspezifische Symptome auf, wie Abnahme von Futteraufnahme und Legeleistung, Eischalenveränderungen und Durchfall. Sekundärinfektionen können hier zu einer klinischen Verschlechterung führen [6].
Beim Auftreten von mehr als 3 Todesfällen pro Tag in einem Bestand von unter 100 Tieren sollte eine Infektion mit AIV in Betracht gezogen werden und eine Ausschlussuntersuchung nach GeflPestSchV2 muss erfolgen. Gleiches gilt bei einem Legeleistungsabfall des Bestandes von mindestens 5%. Kloakentupfer oder Organproben infolge einer Sektion können zum Nachweis mittels PCR genutzt werden.
MERKE
Nicht vergessen: Beim Nachweis von HPAIV und LPAIV sowie ND beim Huhn handelt es sich um anzeigepflichtige Tierkrankheiten (TierSeuchAnzV)!
Syngamus trachea
Syngamus trachea (Luftröhrenwurm) gehört zu den Nematoden und parasitiert in der Luftröhre von Hühnern. Die Würmer entwickeln sich ohne Zwischenwirt und können daher bei Tiergruppen mit und ohne Auslauf vorkommen. Feuchtigkeit und hohe Temperaturen wirken sich begünstigend aus. Stapelwirte, wie der Regenwurm, und Wildvögel können das Infektionsrisiko bei Haltungen mit Auslauf erhöhen [4], [6]. Die Würmer lösen katarrhalisch-hämorrhagische Entzündungen in der Trachea aus, betroffen sind vor allem Küken im Alter von 3 – 4 Wochen. Bereits ein geringgradiger Befall führt zu klinischer Symptomatik mit Dyspnoe, röchelnden oder pfeifenden Atemgeräuschen, Husten und häufigem Kopfschütteln.
Bei Verlegung der Trachea kann es zu Erstickungsanfällen kommen [4], [6]. Teilweise sind die adulten Würmer bei der Untersuchung in der Trachealöffnung sichtbar, bei Küken kann man sie bei Begutachtung vor einer starken Lichtquelle als Verschattung im Tracheallumen erkennen. Alternativ lassen sich die Eier von S. trachea über die Flotationsmethode im Kot nachweisen [4], [6]. Eine regelmäßige Kotuntersuchung wird dringend angeraten.
Aspergillose
Mykosen treten beim Geflügel eher sporadisch auf, sind aber gerade in Hobbyhaltungen anzutreffen. Die Aspergillose ist eine primär den Respirationstrakt betreffende Pilzinfektion, die meist durch Schimmelpilze der Gattung Aspergillus spp. ausgelöst wird. Dabei handelt es sich um eine Faktorenerkrankung, die immer in Zusammenhang mit anderen Infektionserregern oder als Folge von Ernährungs-, Hygiene- und anderen Managementfehlern auftritt [6]. Die infektiösen Pilzsporen gelangen in der Regel durch kontaminiertes Futter oder Einstreu in den Geflügelbestand, die Menge ist hier entscheidend. Ungünstige Bedingungen des Stallklimas, wie eine unzureichende Lüftung, zu hohe Luftfeuchtigkeit oder zu feuchte Einstreu, begünstigen das Pilzwachstum und steigern so die Gefahr einer Infektion [6]. Weitere infrage kommende Schimmelquellen aus der Umwelt, wie ein Kompost in direkter Umgebung, sollten bei der Anamnese gezielt erfragt werden. Eine Übertragung von Tier zu Tier ist nicht bekannt.
MERKE
Für Küken ist ein unhygienischer Brutschrank die Hauptansteckungsquelle, da hier optimale Bedingungen für das Pilzwachstum herrschen. Bei Brutschrankkontaminationen kann es außerdem zu verminderten Schlupfraten kommen [4], [6].
Die Pilzsporen siedeln sich nach Inhalation in der Lunge und den kaudalen Luftsäcken an, von dort aus kann die Infektion je nach Immunitätslage des Tieres sekundär generalisieren. Einige Aspergillus spp. sind in der Lage, Toxine zu produzieren, wodurch es zu plötzlichen Todesfällen kommen kann. Junge sowie durch Stress oder Immunsuppression vorbelastete Tiere zeigen eine erhöhte Anfälligkeit für akute Aspergillose, die Mortalität kann bis zu 50 – 90% erreichen. Bei einer chronischen Erkrankung zeigen die Tiere in der Regel unspezifische Symptome wie Apathie und Gewichtsverlust. Respiratorische Symptome treten erst kurz vor dem Tod ein.
In der Sektion werden fibrinös-entzündliche bis granulomatös veränderte Lungen- und Luftsackbereiche festgestellt und ein aktiver Pilzrasen auf den Luftsackmembranen gilt als pathognomonisch [4]. Diagnostisch erfolgt die mykologische Anzucht aus verändertem Gewebe im Rahmen der Sektion. Am lebenden Tier ist der Nachweis anhand von Tupferproben aus der Trachea nicht aussagekräftig. Hingegen sind Tupferproben, die im Rahmen einer Endoskopie direkt aus veränderten Luftsackbereichen genommen werden, von diagnostischem Wert. Es ist in jedem Fall zu beachten, dass Pilzsporen ubiquitär vorkommen und es bei der Anzucht zu falsch positiven Ergebnissen (Kontaminationen) kommen kann. Die Ergebnisse sollten in Kombination mit der klinischen Symptomatik und den pathologischen Befunden bewertet werden [4], [6]. Gegebenenfalls können Granulome in der Lunge und den Luftsäcken sowie Verdickungen der Luftsackwände mittels Röntgenbildern dargestellt werden.
Nicht-infektiöse Ursachen
Auch nicht-infektiöse Ursachen können zu Veränderungen des Respirationsapparats bei Hühnern führen und das Auftreten von infektiösen Sekundärerkrankungen begünstigen. Dabei handelt es sich größtenteils um Faktoren, die durch gutes Management minimiert werden können. Ein Mangel an Vitamin A führt neben Immunsuppression zu Konjunktivitis und Keratinisierung der Schleimhäute, unter anderem des Respirationstrakts. Infolgedessen wird die Funktion der Schleimhautbarriere eingeschränkt und es kommt zu seromukösem Nasenausfluss. Solche Mangelerkrankungen treten vor allem bei Eigenmischungen von Futtermitteln auf [4], [6].
Weiterhin sind die Luftqualität sowie das Klima im Stall entscheidende Faktoren. Diese werden unter anderem durch die Besatzdichte, die Einstreu- und Futterqualität, die Luftrate, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur beeinflusst. Eine hohe Besatzdichte sowie eine schlechte Qualität von Futter oder Einstreu (z. B. hoher Staubgehalt) wirken sich negativ aus. Bei unzureichender Belüftung steigen die Temperaturen, der Staubgehalt sowie die Schadgaskonzentrationen (z. B. Ammoniak) im Stall. Dies spielt vor allem im Winter eine große Rolle, wenn Lüftungen aufgrund der kalten Temperaturen geschlossen werden. Die Folge ist eine Reizung der Schleimhäute des Respirationstrakts. Hohe Temperaturen wirken sich außerdem negativ auf das Immunsystem der Hühner aus. Bei niedrigen Außentemperaturen treten respiratorische Erkrankungen häufiger und massiver auf. Die Tiere sollten jederzeit Zugang zu witterungsgeschützten Bereichen haben.
Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen, bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit hingegen trocknen die Schleimhäute des Respirationstrakts aus [7], [10], [11]. Im Frühjahr und Herbst werden Hühner häufig mit Schnupfen oder Niesen vorgestellt, ohne dass eine spezifische Ursache ermittelt werden kann. Ein Zusammenhang mit den hohen Temperaturschwankungen und damit einhergehenden Änderungen der Luftfeuchtigkeit und des Ammoniakgehalts werden vermutet. Eine ausreichende Belüftung ist in dieser Zeit daher sehr wichtig [9].
Diagnostik
In der Nutzgeflügelmedizin ist die Sektion, auch in Kombination mit der diagnostischen Tötung eines erkrankten Tieres, von großer Bedeutung. Im Fall von Hobbyhaltungen und Liebhabertieren wird diese seltener und vorrangig an bereits verstorbenen Tieren durchgeführt. Vorteile dieser Methode sind der umfassende Erkenntnisgewinn durch typische pathologische Veränderungen und die Möglichkeit von Organprobenentnahmen für histologische und andere weiterführende Untersuchungen. Die in (Tab. 1) aufgeführten Untersuchungen können somit auch direkt aus im Rahmen der Sektion entnommenen Organproben durchgeführt werden.
Am lebenden Tier stellen die bakterielle Anzucht mit Erstellung eines Antibiogramms sowie der Nachweis von Erregergenom mittels PCR aus Tupferproben (direkter Nachweis) die gängigsten Untersuchungsmethoden für die vielfältigen infektiösen Ursachen von Atemwegserkrankungen beim Huhn dar. In (Tab. 1) sind die gängigsten Untersuchungsmethoden und geeignetes Probenmaterial häufiger Atemwegsinfektionen am lebenden Huhn zusammengefasst. Bei einigen Erkrankungen ist auch eine serologische Untersuchung (indirekter Nachweis) auf das Vorhandensein von Antikörpern gegen den Erreger einer Erkrankung möglich. Hierbei ist allerdings essenziell, den Impfstatus der Tiere in Erfahrung zu bringen, da eine Unterscheidung zwischen der Antikörperbildung infolge einer Infektion bzw. Impfung nicht möglich ist.
Röntgendiagnostik
Bei einem Verdacht auf raumfordernde Prozesse als Ursache für Atemnot können Röntgenbilder hilfreich sein. Allerdings muss sorgfältig abgewogen werden, ob der Allgemeinzustand des Tieres die Untersuchung zulässt, da die Lagerung (vor allem dorsoventral) die Atemtätigkeit, die ausschließlich durch Bewegung des Brustbeins erfolgt, erschwert und dies zu Herz-Kreislauf-Versagen führen kann. Bei Verdacht auf Aszites sollte zunächst durch Punktion der Körperhöhle ein Großteil der Flüssigkeit abgelassen werden. Neben Umfangsvermehrungen in der Körperhöhle können chronische Veränderungen der Lungenstruktur oder der Luftsäcke sowie Granulome (z. B. durch Aspergillose, Tuberkulose) gegebenenfalls im Röntgenbild sichtbar werden.
Fazit
Durch die zunehmende Beliebtheit von Hühnern, auch in der Hobbyhaltung, gewinnt das Wissen um Klinik und Diagnostik von respiratorischen Erkrankungen bei diesem besonderen Patienten an Bedeutung. Wichtig ist, mit der richtigen Diagnostik die zugrunde liegenden Erreger und Begleitfaktoren zu erkennen, um dann eine zielgerichtete Therapie einzuleiten. In einem weiteren Beitrag der Autorinnen wird in Kürze das Thema „Therapie und Prophylaxe von Atemwegserkrankungen beim Huhn“ bearbeitet und veröffentlicht werden.
Der Originalbeitrag zum Nachlesen:
Westhoff K., Nemitz S. "Das Hobbyhuhn als Patient – Ursachen und Klinik von Atemwegserkrankungen" veterinär spiegel 2023; 33(02): 79-88 DOI: 10.1055/a-2062-7696
- Kummerfeld N. Hobbygeflügel als „neue“ Heimtiere in der Kleintierpraxis. Prakt Tierarzt 2021; 84-92
- Scanes CG. ed. Sturkieʼs avian physiology. Amsterdam, Boston, Heidelberg, London: Academic Press; 2015
- Tully TN. Avian Respiratory Diseases: Clinical Overview. J Av Med Surg 1995; 9: 162-174
- Lierz M, Heffels-Redmann U. Respiratory disorders. In: Poland G, Raftery A. Hrsg. BSAVA manual of backyard poultry medicine and surgery. Quedgeley: BSAVA; 2019: 160-177
- Greenacre CB. Physical Examination. In: Greenacre CB, Morishita TY. Hrsg. Backyard Poultry Medicine and Surgery: A Guide for Veterinary Practitioners. 02. Newark: Wiley & Sons; 2021: 158-172
- Rautenschlein S, Ryll M. Erkrankungen des Nutzgeflügels. Ursachen, Klinik, Pathologie, Diagnosen, Prophylaxe und Bekämpfung. Stuttgart: UTB; 2014
- Gartner AM, Hampe A, Oberländer B. Tierärztliche Betreuung von Hühner-Kleinstbeständen in der Hobbyhaltung. CVE Vetimpulse 2018; 1-44
- Ferguson-Noel N, Armour NK, Noormohammadi AH. Mycoplasmosis. In: Swayne DE. Hrsg. Diseases of poultry. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell; 2020: 907-965
- Fulton RM. Respiratory Diseases. In: Greenacre CB, Morishita TY. Hrsg. Backyard Poultry Medicine and Surgery: A Guide for Veterinary Practitioners. 2. Newark: Wiley & Sons; 2021: 218-228
- Pantin-Jackwood MJ, Spackman E. Multicausal Respiratory Diseases. In: Swayne DE. Hrsg. Diseases of poultry. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell; 2020: 1386-1388
- Darren K. Basic Housing and Management. In: Greenacre CB, Morishita TY. Hrsg. Backyard Poultry Medicine and Surgery: A Guide for Veterinary Practitioners. 2. Newark: Wiley & Sons; 2021: 45-55