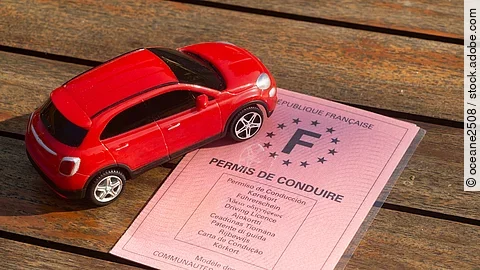Inhalt

Das Sommerekzem, auch bekannt unter den Namen Sweet Itch, Queensland Itch oder Insect bite hypersensitivity (IBH), ist die häufigste allergische Hauterkrankung bei Pferden. Es wird verursacht durch eine Hypersensitivitätsreaktion auf das Speichelprotein von Insekten, vor allem der Gattung Culicoides. Daher wird die Erkrankung auch Culicoides-Hypersensitivität (CH) genannt [1], [2].
Weltweit variiert die Prävalenz von 3% in Großbritannien über 37% in Deutschland zu bis zu 60% in Australien, abhängig von der geografischen Ausbreitung der Culicoides-Insekten [3] – [6].
Eine erhöhte Prävalenz für die Entstehung des Sommerekzems besteht vor allem bei Islandpferden, die exportiert werden [7]. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ursprünglich Culicoides-Mücken in Island nicht endemisch waren. Islandpferde entwickeln daher in den ersten Lebensjahren, wenn sie diese auf Island verbringen, keine immunologische Toleranz für die Speichelproteine der Culicoides-Mücken (reviewed in Schaffartzik, 2012 [8]). Es konnte kürzlich erst gezeigt werden, dass an Sommerekzem erkrankte Pferde, die auf Island geboren wurden, signifikant höhere allergen-spezifische IgE-Konzentrationen aufwiesen als Pferde, die in Ländern geboren wurden, in denen Culicoides vorkommen [7]. Die Prävalenz bei Isländern steigt mit ansteigendem Exportalter [9].
Das Sommerekzem ist eine saisonal auftretende Erkrankung und kommt typischerweise in den warmen Monaten von Frühling bis Herbst vor, wenn die Culicoides-Mücken aktiv sind. In seltenen Fällen können schwerwiegend chronisch erkrankte Pferde auch ganzjährig betroffen sein [8], [10].
Das Hauptsymptom ist ein ausgeprägter Juckreiz , der vor allem an Mähne (Abb.1) und Schweifrübe auftritt. Aber auch andere Körperstellen wie Kopf, Unterbrust, Unterbauch und das Präputium bzw. das Euter können betroffen sein. Durch das vermehrte Kratzen werden Primärläsionen wie Rötungen, Ödeme, Vesikel und Papeln häufig nicht gesehen. Eher werden Sekundärläsionen wie Alopezie, trockene und schuppige Haut, Hyperkeratose, Exkoriationen, blutige Krusten und Lichenifikation wahrgenommen.