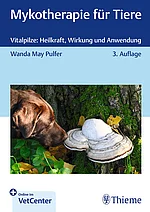Inhalt

Ökologie und Geschichte
Pilze der Gattung Auricularia zählen zu den ältesten Speisepilzen der Welt. Sie werden in allen Schriften aus dem chinesischen Altertum beschrieben, die zurück bis ins 2. und 3. Jahrhundert vor Christus reichen. In Asien wird der Auricularia auch Mu Err genannt, was so viel wie Waldohr oder Baumohr bedeutet. Heute wie früher wird er gerne und in großer Menge verzehrt. Vor 300 bis 400 Jahren wurde er auch in Europa bekannt.
Aufgrund seines eher faden Geschmacks aß man hierzulande den Pilz nicht, aber verwendete ihn als Heilmittel. Seinen deutschen Namen „Judasohr“ verdankt der Auricularia einer biblischen Überlieferung: Danach soll sich Judas, einer der 12 Jünger und später Verräter Jesu, an einem Holunderbaum erhängt haben. An dessen Stamm wuchsen daraufhin Pilze, die eine ohrmuschelartige Form hatten. Tatsächlich wächst der Auricularia bevorzugt am Holz von Laubbäumen, besonders häufig aber am Holunderbaum.
Info
Die beiden Pilze Auricularia polytricha und Auricularia auricula-judae werden in der Literatur wiederholt gleichgesetzt oder sogar als identisch bezeichnet. Die Mykologen Po Liu und Yun-sun Bau bestätigten im Jahre 1980 in ihrer Abhandlung „Fungi Pharmacopoeia“, dass die beiden Arten hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe und Verwertbarkeit als Nahrung austauschbar sind.
Wirkung
Steckbrief Auricularia polytricha
Wirkung
- blutgerinnungshemmend
- thrombozytenaggregationshemmend
- durchblutungsfördernd und antithrombotisch
- entzündungshemmend auf Haut, Augen und Schleimhäute
- krebshemmend
- blutzuckersenkend und antidiabetisch
- schützend und befeuchtend auf die Schleimhäute
- regulierend auf den Fettstoffwechsel (Cholesterin, LDL, Triglyceride)
- atherosklerosehemmend
- immunstabilisierend
- antioxidativ und radikalfangend
- blutdrucksenkend
- stärkend und schützend auf das Bindegewebe
Einsatzgebiete beim Tier
- Durchblutungsstörungen (auch nach Unfällen)
- Stenosen, Cauda-equina-Syndrom
- Entzündungen von Augen, Haut, Schleimhaut und Bindegewebe
- Lipidkeratopathie
- Herz- und Herzgefäßerkrankungen
- Sommerekzemprophylaxe
- Lähmungen, Gefühllosigkeit der Extremitäten
- Entzündung der Analdrüsen, Analfisteln, Hämorrhoiden
- Krebserkrankungen (Sarcoma, Darm- und Lungenkrebs)
- Regulation des Blutdrucks
- Begleitende Therapie bei Hufrehe und Arthrose
Inhaltsstoffe
Der Auricularia enthält die Mineralstoffe Natrium, Kalium, Kalzium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Mangan sowie wenig Zink. Daneben sind in seinem Fruchtkörper alle Vitamine der B-Gruppe zu finden, wenn auch in moderaten Mengen. Auch Vitamin A und C sowie Ergosterol (Provitamin D2) kommen vor. Darüber hinaus weist der Pilz ein Vorkommen aller essenziellen Aminosäuren auf. Die sekundären Inhaltsstoffe von Auricularia bestehen vor allem aus Polysacchariden, Glycoproteinen, Lektinen, Polyphenolen und dem Nukleosid Adenosin.
Wirkung auf Blut und Blutgefäße
Das Judasohr hat traditionell einen besonders starken Bezug zum Blut, den Blutgefäßen und den Schleimhäuten. Der Mu-Err, wie er in China genannt wird, enthält diverse sekundäre Stoffe mit durchblutungsfördernder Wirkung. Genauer üben gemäß einer Studie aus dem Jahr 1988 die enthaltenen Lektine eine gerinnungshemmende Wirkung auf das Blut aus. Aber auch die Polysaccharide des Pilzes verfügen über diese thrombinhemmende Eigenschaft.
Zusätzlich wurde anhand von mehreren Studien die thrombozytenaggregationshemmende und damit hemmende Wirkung verschiedener Inhaltsstoffe des Pilzes auf die Verklumpung von Blutplättchen bestätigt. Die antikoagulante Wirkung von Auricularia kann im Vergleich mit anderen Pilzen, dicht gefolgt von Shiitake, als die stärkste unter den heilsamen Pilzen angesehen werden. Diese Effekte wirken sich positiv auf die Viskosität des Blutes aus und verbessern dadurch dessen Fließeigenschaft. Gleichzeitig schützen die Wirkstoffe aus Auricularia polytricha die Blutgefäße und führen nicht zu Kollagenschäden, wie einige chemische Blutverdünner dies tun.
Alle diese Eigenschaften machen den Pilz zu einem wertvollen Mittel zur Behandlung und Prävention von Thrombosen, Herzinfarkt und Schlaganfällen. Aber auch bei allen anderen Durchblutungsstörungen wie sie bei Lähmungen, Stenosen (Cauda equina), Hufrehe und koronaren Herzerkrankungen vorkommen, kann der Pilz eingesetzt werden. Die antiatherosklerotische und lipidsenkende Wirkung des Pilzes unterstützt die Gesundheit der Koronargefäße des Herzens zusätzlich. Dieser hypolipidämische Effekt mit signifikanter Senkung von Cholesterin, LDL-Cholesterin und Triglyceriden konnte anhand einer Studie aus dem Jahr 2002 den vorkommenden Biopolymeren und im Jahr 2011 zusätzlich den phenolischen Komponenten des Pilzes zugesprochen werden.
Antidiabetische Wirkung
Seit dem Jahr 1989 wurde Auricularia auch eine antidiabetische Wirkung zugesprochen. Man ging davon aus, dass die Polysaccharide der Pilze eine schützende Wirkung auf die Inselzellen der Bauchspeicheldrüse ausüben. Neun Jahre später wurde eine Untersuchung an diabeteskranken Mäusen durchgeführt, bei denen nach der Supplementation der wasserlöslichen Polysaccharide eine erhebliche Senkung des Blutzuckers in Blut und Urin, von Insulin sowie eine verminderte Nahrungsaufnahme festgestellt werden konnte.
Entzündungshemmende Wirkung
Die in Auricularia vorkommenden Polysaccharide, darunter auch Beta-D-Glucane, verfügen auch über eine entzündungshemmende Wirkung besonders auf die Augen, die Haut und die Schleimhäute. Aus diesem Grund kann der Pilz auch solchen Tieren Linderung verschaffen, die an entzündlichen Reaktionen leiden, wie sie bei allergischen und autoimmunen Reaktionen wie beispielsweise dem Sommerekzem und der Mondblindheit beim Pferd vorkommen. Aber auch bei entzündeten Analbeuteln und -drüsen, bei Analfisteln oder Hämorrhoiden kann der Pilz aufgrund seiner antiinflammatorischen und blutverdünnenden Effekte hilfreich sein.
Antikanzerogene Wirkung
Die von den Polysacchariden aus Auricularia ausgehende hemmende Wirkung gegen Sarcomatumore wurde bereits anhand der Untersuchungen von Prof. Ikekawa im Jahr 1969 beschrieben und später, 1981, auch von dem japanischen Wissenschaftler A. Misaki und seinem Team. Auch neuere chinesische Studien bescheinigen den Polysacchariden aus Auricularia eine antikanzerogene Wirkung gegen Sarcomatumore sowie zudem eine dosisabhängige antiproliferative und apoptosestärkende Wirkung gegen Lungen- und Darmkrebszellen.
Darüber hinaus wirken die Polysaccharide aus Auriculariaantimutagen und damit der Entartung von Zellen entgegen. Auch ein spezifisches Protein (APP) aus Auricularia besitzt immunmodulierendes Potenzial. Studien haben gezeigt, dass diese Stoffe die Immunabwehr aktivieren können und bestimmte Immunzellen zur Produktion von Gamma-Interferon sowie des Tumornekrosefaktors animieren.
Antioxidative Wirkung
Neben seinem Einfluss auf das Immunsystem sind von Auricularia auch antioxidative und radikalfangende Eigenschaften bekannt. Bereits im Jahr 1989 wurde bereits von H. Zhou und seinem Team über die Eigenschaft der Polysaccharide aus Auricularia berichtet, welche die Superoxiddismutase-Aktivität in Hirn und Leber von behandelten Mäusen erheblich erhöhten und damit gegen oxidativen Stress wirken. Auch von einer MAO-B-Hemmung im Gehirn von Mäusen wurde gesprochen wie auch von einem Rückgang des Pigmentes Lipofuscin im Herzen der behandelten Tiere, welches altersbedingt aufgrund von Schäden an Zellmembranen und Mitochondrien auftritt. Alle diese Effekte sprechen Auricularia auch eine Anti-Aging-Wirkung zu.
Der Originalartikel ist erschienen in:
Die einzelnen Pilze im Überblick. In: Pulfer W, ed. Mykotherapie für Tiere. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart: Thieme; 2025. doi:10.1055/f-0003-0001-b000001042
(JD)