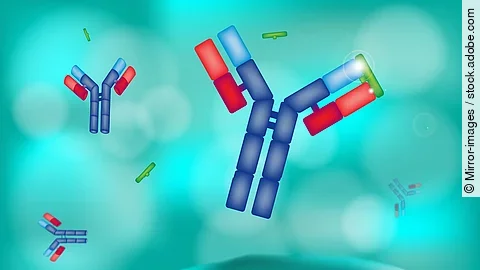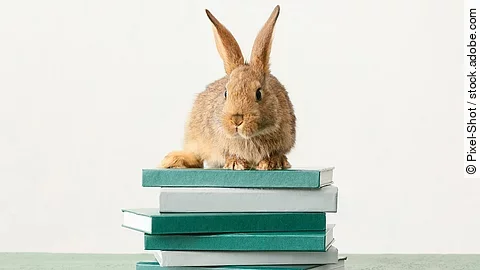An der Universität des Saarlandes haben Forschende ein Verfahren entwickelt, um die Lungen geschlachteter Schweine noch sinnvoll zu nutzen – nämlich als praxistaugliches und aussagekräftiges Lungen-Modell für die Forschung. Ziel sei es, Tierversuche zu ersetzen, zu reduzieren und diese sogar von deren Möglichkeiten und Aussagekraft her zu übertreffen, so die Aussage der Forschungsgruppe. Die Mediziner*innen halten die Lungen bis zu 24 Stunden stabil, was zuvor keiner anderen Gruppe weltweit gelungen ist.
Labor erinnert an Intensivstation
Damit die Lunge so lange stabil bleibt ist viel Technik notwendig. Von Überwachungsmonitoren bis zum Beatmungsgerät und Infusionspumpen – all diese Geräte sind mit der Lunge verbunden, die in einem feuchten Glaskasten aufbewahrt wird. Das Organ wird somit beatmet und durchblutet: Eine spezielle Vorrichtung ersetzt das Herz und pumpt exakt auf 37 Grad erwärmtes und bereits mit Kohlendioxid und Sauerstoff versetztes Schweineblut durch die Lungenarterie bis in das dichte Netz an kleinsten Blutgefäßen – bevor es wieder aus der Lungenvene in den Behälter der Pumpe fließt.
„Es handelt sich um ein lebendes Organ“, betont Professor Sascha Kreuer, „wir müssen die Lunge permanent befeuchten und ihren Stoffwechsel in Gang halten.“ Der Mediziner ist Professor an der Universität des Saarlandes und leitet das Labor für experimentelle Anästhesiologie am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Gemeinsam mit Professor Thomas Volk, Direktor der Universitätsklinik für Anästhesiologie, und dem Experten für Gassensorsysteme Christian Bur arbeitet Kreuer daran, Tierversuche für die pharmazeutische und medizinische Forschung zu reduzieren.
Universelle Forschungsplattform
Durch den eigenen Metabolismus der Lunge können die Forschenden an ihr unter lebensechten Bedingungen unter anderem Medikamente auf ihre Wirkung testen und in der Ausatemluft messen.
„Wir schaffen mit dem Lungenmodell eine universelle Forschungsplattform, an der wir vielfältigere Tests möglich machen, als dies bei Versuchstieren der Fall wäre“, erklärt Klinikdirektor Thomas Volk. Unter echten Bedingungen lassen sich so etwa neue Wirkstoffe testen, zum Beispiel solche, die inhaliert werden: Dafür vernebeln die Mediziner*innen das Inhalat direkt in der Lunge. Das Organ kann auch ausgespült und die Zusammensetzung der so gewonnenen Flüssigkeit analysiert werden. „Wir können auch Wirkstoffe dem Blut zusetzen, das die Lunge versorgt, und messen anschließend deren Konzentration berührungslos in der Ausatemluft. Dadurch können wir mit dem Modell etwa die individuelle Dosierung von Arzneistoffen erforschen und die Möglichkeiten der Medikamentenüberwachung erweitern“, sagt Sascha Kreuer.
Bislang werden Medikamentenspiegel meist über Blutanalysen bestimmt, was aufwändig und kostenintensiv ist und zu zeitversetzten Ergebnissen führt. Wenn sich mit dem Lungenmodell erforschen ließe, ob Medikamente in die Ausatemluft übergehen, wäre dies der erste Schritt hin zu einer berührungsfreien, schnellen und einfachen Atemgasanalyse. „Auch ein Modell für eine Lungeninfektion wird möglich. Wir können Teile des Organs mit Erregern infizieren, um im Anschluss Ausatemluft oder Gewebe zu untersuchen“, ergänzt Thomas Volk.
Analyse der Ausatemluft
Die Analyse der Ausatemluft ist Forschungsschwerpunkt von Professor Sascha Kreuer. Ihm war es in mehrjähriger Forschung gelungen, das Verfahren, mit dem das Narkosemittel Propofol in der Atemluft gemessen wird, zu optimieren. „Auch mit dem Lungenmodell konnten wir zeigen, dass Propofol von der Lunge verstoffwechselt werden kann. Dies wurde bisher vermutet, konnte aber nicht nachgewiesen werden“, erklärt Sascha Kreuer. „Wir können in der Ausatemluft unseres Lungenmodells generell die Konzentration von Wirkstoffen oder ihrer Abbauprodukte messen. Darauf basierend errechnen wir die Konzentration im Blutplasma und ziehen Rückschlüsse auf die Wirkung oder eine individualisierte Dosierung“, erklärt der Forscher.
Das Forschungsteam entwickelt seit rund drei Jahren das gesamte neuartige Verfahren rund um die Lungen-Forschungsplattform – es gab kaum Erfahrungswerte, auf die sie zurückgreifen konnten. Zum einen erarbeiteten die Mediziner die zahlreichen einzelnen Handlungsschritte, um die Lunge zu versorgen. Zum anderen stimmte das Team in seinen Experimenten sämtliche technischen Vorrichtungen auf das Verfahren ab – bis hin zu den maßgefertigten Verbindungsanschlüssen zwischen Technik und Lunge und den ausgefeilten Messmethoden zur Analyse der Ausatemluft.
Quelle (nach Angabe) von:
Lebende Lunge ersetzt Tierversuche | Universität des Saarlandes
(JD)