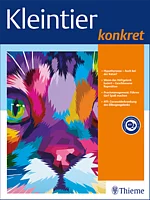Inhalt

Einführung
Bereits 1972 gab H. G. Niemand in seinem Klassiker, dem „Praktikum der Hundeklinik“ [2], den Hinweis, ohne Assistenz vor der Euthanasie mit Barbituraten eine Neuroleptanalgesie durchzuführen. Eine spätere Auflage der Hundeklinik im Jahre 2006 widmet dem Thema Euthanasie schon 7 Seiten [3]. In den letzten Jahren beschäftigen sich Publikationen und Seminare mit dem Thema Einschläfern und ein veterinärmedizinischer Großhandel bietet seit Jahren Trauerkarten an, mit denen die Tierarztpraxis Patientenbesitzer*innen nach dem Einschläfern kondolieren kann.
Am Thema Euthanasie kristallisiert sich der Paradigmenwechsel, dass das Tier nicht mehr als Tier, sondern als Familienmitglied wahrgenommen wird, besonders deutlich.
Definition
Der historisch nicht unbelastete Begriff Euthanasie bedeutet „schmerzlose Tötung“ [4]. Üblicherweise wird hierzu in der Tiermedizin ein geeignetes und zugelassenes Medikament injiziert. Mehr oder weniger glückliche Synonyme für Euthanasie sind Tötung, Sterbehilfe oder Einschläfern.
Gesetzliche Grundlagen aus praktischer Sicht
Das Einschläfern von Tieren wird im Wesentlichen durch 2 Paragrafen des Tierschutzgesetzes geregelt:
- In § 4 wird die nötige Sachkunde für das Töten von Tieren vorgeschrieben.
- § 17 droht mit Sanktionen für das Töten von Tieren ohne vernünftigen Grund.
Der „vernünftige“ Grund
Die Bestimmung des „vernünftigen“ Grundes für die Euthanasie ist das Kernproblem jeder Euthanasie und bereitet oftmals große Probleme. Die schlussendliche Entscheidung, ob ein Tier erlöst wird oder nicht, treffen die Besitzer*innen. Es ist jedoch tierärztliche Kernkompetenz, den „vernünftigen“ Grund zu detektieren und die Besitzer*innen zur Entscheidung, ob sie ihr Tier einschläfern lassen oder nicht, hinzuführen.
Auch wenn jeder Fall individuell zu beurteilen ist, gibt die Fachliteratur beispielhaft mögliche „vernünftige“ Gründe an:
- „ein schlechter Allgemeinzustand infolge einer Kombination altersbedingter Gesundheitsprobleme. Weitere Gründe sind Krankheiten mit infauster Prognose (v. a. maligne tumoröse Erkrankungen mit Metastasierung), schwere Traumata, medikamentös nicht mehr zufriedenstellend beherrschbare, v. a. schmerzhafte Krankheiten“ [3].
- „… quälende Altersschwäche, nicht therapierbare Verhaltensstörungen, z. B. hochgradige Aggressivität, … und Menschen gefährdet sind …“ [6].
Ein vernünftiger Grund ist sicherlich immer dann gegeben, wenn es aufgrund der Lage des Falles unwahrscheinlich erscheint, ein Tier so behandeln zu können, dass es schmerzfrei oder zumindest mit vertretbaren Schmerzen weiterleben kann. Auch bei der Auswahl palliativer Maßnahmen, z. B. der Behandlung eines Übergangzellkarzinoms mittels COX-2 Hemmern, gilt dies zu beachten.
Genauso wichtig wie der vernünftige Grund zur Begründung der Euthanasie ist, ist auch das Nichtvorliegen eines vernünftigen Grundes für die Verweigerung einer Euthanasie.
Merke
Die Darlegung des vernünftigen Grundes und dessen Dokumentation in der Kartei sind absolut essenziell, um als praktische*r Tierärztin bzw. Tierarzt forensisch auf der sicheren Seite zu bleiben.
Das Einschläfern eines Tieres ohne vernünftigen Grund ist ein Straftatbestand und kann in der Vita von Tierärzt*innen fatale Folgen haben.
Vorbereitung des Einschläferns
Oftmals zeichnet sich die Notwendigkeit bei chronisch kranken Patienten drohend im Vorfeld ab. In diesen Fällen sollte man die Gelegenheit ergreifen, das Einschläfern mit dem Besitzenden zu besprechen. Dazu gehört auch die Aufklärung darüber, was mit dem eingeschläferten Tier geschehen kann und was geschehen soll.
Allen Beteiligten wird die Euthanasie erleichtert, wenn im Vorfeld einer Einschläferung bereits folgende Punkte im gemeinsamen Fokus von Tierärzt*innen und Tierbesitzer*innen sind:
- Wenn möglich, Planung mit „dem Kopf“ vor der „Bauchphase“.
- Die Besitzer*innen müssen entscheiden. Tierärzt*innen können nur dabei helfen, indem sie die Indikation stellen, aber das klar, deutlich und überzeugend! Approbierte Tierärzt*innen übernehmen eine verantwortungsvolle Entscheidung, aber sie dürfen sich im Interesse ihrer Patienten nicht vor der Verantwortung drücken!
- Die betreuenden Tierärzt*innen müssen authentisch auftreten – direkte und indirekte Kommunikation müssen übereinstimmen.
- Nur eine von den Besitzer*innen selbst getroffene Entscheidung ist eine belastbare und dauerhaft gute Entscheidung.
Pharmakologische Grundlagen aus praktischer Sicht
Barbiturate
Dieser Inhalt unterliegt den Bestimmungen gemäß Heilmittelwerbegesetz (HWG) und darf nur berechtigten Personen zugänglich gemacht werden. Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Inhalt zu sehen.
Durchführung des Einschläferns
Das Einschläfern ist für Tierbesitzer*innen die mit Abstand bedeutendste tierärztliche Maßnahme, die an ihrem Tier im Laufe seines Lebens vorgenommen wird. Dieser für die Besitzer*innen furchtbare Moment wird ihnen mehr in nachhaltender Erinnerung bleiben als die komplizierteste Osteosynthese, die 5 Jahre zuvor erfolgreich durchgeführt wurde.
Einschläfern ist – zumindest bei langjährigen Patienten – „Chefsache“ und entscheidet darüber, in welcher Erinnerung die Tierbesitzer*innen die Praxis behalten und auch darüber, ob sie mit ihrem nächsten Welpen wieder die alte Praxis aufsuchen. Diese Überlegung „Euthanasie = Chefsache“ sowie die Frage, wie und unter welchen Umständen würde ich mir denn das Einschläfern meines eigenen Hundes wünschen, sollten stets oberste Maxime sein.
Wichtige Voraussetzungen für das Einschläfern eines Kleintiers sind deshalb:
- Zeitplanung: Ecktermin, der Besitzende soll nicht mit roten Augen im vollen Wartezimmer sitzen
- ein ruhiger, absolut störungsfreier Raum
- Kennzeichnung außen an der Tür

Alle diese Maßnahmen dienen dazu, die Intimität des Einschläferns zu garantieren.
Wichtige Punkte bei der Durchführung des Einschläferns sind:
- grundsätzlich Narkose vor dem Einschläfern (speziesunabhängig)
- Pentobarbital möglichst i. v. am narkotisierten Tier
- möglichst in Anwesenheit der Besitzer*innen
- professionelle Feststellung des Todes (Herz, Puls, Pupillenreaktion), deutliche und klare Aussage gegenüber dem Besitzenden: „Das Herz schlägt nicht mehr, Ihr Tier ist tot.“
- ausreichend Zeit für den Besitzenden, um von seinem toten Tier Abschied zu nehmen
Die Tierart oder gar die Körpergröße des Tieres spielen beim Einschläfern für das momentum emotionale überhaupt keine Rolle. Auch Kleinsäuger, Reptilien, Vögel und ganz besonders Psittaziden sind langjährige Familienmitglieder, die nicht weniger würdevoll eingeschläfert werden müssen als Hunde oder Katzen.
Besondere Beachtung verlangt der Umstand, wenn Kinder beim Einschläfern „ihres“ Tieres anwesend sind. Der Autor hat – auch mit seinen eigenen Kindern – die Erfahrung gemacht, dass Kinder, wenn sie dabei sein wollen, auch dabei sein sollen. Kinder trauern oft anders als Erwachsene, vielleicht auch intensiver und heftiger. Es ist nicht sinnvoll, den Kindern etwas vorzumachen oder gar zu lügen. Den meisten Kindern erleichtert man den Abschied von ihrem Tier, wenn man ihnen kindgerecht erklärt, worum es geht.
Betreuung der Besitzer*innen – Verlustpsychologie
Überbringer schlechter Nachrichten wurden im Altertum hingerichtet. Auch in der Neuzeit hat sich daran nur wenig geändert. Der Augenblick, in dem die Notwendigkeit der Euthanasie von dem Tierarzt bzw. der Tierärztin klar und deutlich ausgesprochen wird, ist ein Moment enormer Emotionalität, die sich im schlimmsten Fall unkontrolliert Bahn brechen kann.
Forensische Erfahrungswerte zeigen, dass Einschläfern häufig zu einem Gerichtsfall werden kann, wenn die Tierbesitzer*innen Trauer und Frustration den vermeintlich Verantwortlichen, den Tierärzt*innen, anlasten wollen. Um sich in diesem „verminten“ Bereich sicher bewegen zu können, ist die Kenntnis der Verlustpsychologie wichtig.
Menschen verhalten sich unabhängig davon, was verloren wurde, stereotyp:
- 1. Phase: Unglaube
- 2. Phase: Suche nach dem Schuldigen
- 3. Phase: Aggression
- 4. Phase: Trauer
Auch wenn die Tierbesitzer*innen seit Wochen vom Tierarzt oder der Tierärztin mit dem Ausgang der chronischen Erkrankung konfrontiert wurde, kann es immer wieder geschehen, dass die Patientenbesitzer*innen nach etlichen Tierarztbesuchen mit Unglauben reagiert: „Ja, jetzt bin ich vollkommen überrascht, Frau Doktor, das Herz hat doch immer gut gearbeitet!“
In dem Augenblick, in dem die Tierbesitzer*innen erkennen, dass die Euthanasie unausweichlich auf ihr Tier zukommt, werden sie häufig, selbst in schicksalhaften Situationen, nach einem Schuldigen suchen. In dieser Situation laufen behandelnde Tierärzt*innen Gefahr, zum Schuldigen zu werden. Verschärft wird dieses Risiko zusätzlich, sobald sich die Tierärztin oder der Tierarzt in Diskussionen verstricken lässt.
Wer außer Acht lässt, dass selbst die intelligentesten Tierbesitzer*innen in dieser Situation eben nicht intellektuell ansprechbar ist, sondern ausschließlich emotional reagieren, geht das Risiko ein, dass die Situation eskaliert, indem die nächste Phase, die der Aggression, dominiert. Probleme in dieser Phase enden nicht selten mit unschönen und lauten Auseinandersetzungen und gipfeln auch gerne in Leserbriefen, Internetbeschimpfungen oder eben vor Gericht. Es ist für Tierärzt*innen von großer Bedeutung, Phase 3 und 4 zu erkennen und am besten dadurch zu entschärfen, dass man selbst auch emotionale Signale aussendet, den Besitzer*innen ebenfalls die eigene Betroffenheit kommuniziert oder ihn auch einfach mal in den Arm nimmt.
Merke
Aus forensischen Gründen sollte während der Vorbereitung der Euthanasie, des Gesprächs und des definitiven Einverständnisses der Besitzender*innen ein*e Praxismitarbeiter*in im Raum sein, um notfalls als Zeug*in zur Verfügung steht. Um die Intimität zu erhalten, sollte dies möglichst nur ein und während des Einschläfern der gleiche Mitarbeitende sein.
Vorbereitendes Gespräch, Untersuchungsbefunde, der definitive Wunsch der Besitzer*innen nach der Euthanasie sowie die Euthanasie selbst sollten umgehend in die Krankenakte eingetragen werden, um das Einschläfern forensisch abzusichern. Auch eine ruhig und harmonisch abgelaufene Euthanasie kann sich noch Wochen später als Gerichtsfall entpuppen.
Einschläfern und danach?
Die Frage, was mit dem eingeschläferten Tier geschehen soll, ist etwas, was die Besitzer*innen häufig genauso beschäftigt wie die Euthanasie selbst. Auch dieses Thema sollte, wenn immer möglich im Vorfeld, solange die Tierbesitzer*innen noch „kopfmäßig erreichbar“ ist und noch nicht im emotionalen Modus läuft, angesprochen werden.
Dabei ist es ist sinnvoll, sich Zeit zu nehmen, um den Tierbesitzer*innen die verschiedenen Möglichkeiten aufzuweisen:
- Vergraben auf eigenem Gelände
- Tierkörperbeseitigungsanstalt: schwierig zu kommunizieren, ggf. als „eine gesetzlich erlaubte Lösung“
- Tierkrematorium mit verschiedenen Optionen
- Tierfriedhof
Obwohl man ggf. das Gespräch dadurch erleichtern kann, dass man darauf hinweist, wie man mit den eigenen Tieren verfahren hat oder verfahren würde, sollten die Besitzer*innen unbedingt die Entscheidung selbst treffen. Nur eine selbst getroffene Entscheidung ist eine dauerhafte Entscheidung, die von den Besitzer*innen auch langfristig „getragen“ wird.
Haben sich die Besitzer*innen für das Einschläfern entschieden und auch darüber, was mit seinem Tier anschließend geschehen soll, ist es wichtig, diese Entscheidung zu „verankern“: Die Tierärztin oder der Tierarzt sollte den Besitzer*innen in die Augen schauen, ihnen je nach Situation auch am Arm berühren und klar formulieren: „Das ist eine gute Entscheidung, die Sie da jetzt für Ihr Tier getroffen haben.“
Trauerbegleitung
Die American Animal Hospital Association bot bereits in den 80iger Jahren ihren Mitgliedern Postkarten an, auf denen die Praxis kondolieren konnte: „We know how you care“. Trauerkarten mit verschiedenen Texten und Bildern werden mittlerweile auch in Deutschland seit Jahren angeboten. Die Praxis des Autors hat sich vor Jahren nach intensiven, praxisinternen Diskussionen dafür entschieden, Kondolenzkarten zu verschicken. Die Resonanz darauf ist überwiegend positiv, was auch zahlreiche Dankschreiben belegen.
Fazit
Die wichtigsten Punkte rund um eine fachlich korrekte wie forensisch sichere Euthanasie beim Kleintier sind:
- Klare Indikation – klare Kommunikation.
- Begleitung der Besitzer*innen bei ihrer eigenen Entscheidung.
- Durchführung der Euthanasie ruhig, absolut störungsfrei, professionell und sozial kompetent.
- Beachtung der Würde von Tier und Tierbesitzer*innen.
- Trauer und Verlust sind nicht speziesabhängig.
- Die Euthanasie berührt die Emotion, nicht den Intellekt.
Der Originalbeitrag zum Nachlesen:
(JD)
- Rodenbeck H, Rosenhagen C, Steidl T. Die Kleintierpraxis. Frankfurt am Main: bpt; 2001
- Niemand HG. Praktikum der Hundeklinik. Hamburg: Parey; 1972
- von Rechenberg B. Euthanasie bei Hunden und Betreuung der trauernden Tierbesitzer. In: Niemand HG, Suter PF. Praktikum der Hundeklinik. Singhofen: Parey; 2006
- Buck-Werner ON, von Rechenberg B. Euthanasie des Hundes und Besitzerbetreuung. In: Kohn B, Schwarz G. Hrsg. Praktikum der Hundeklinik. 12. Aufl.. Stuttgart: Enke; 2017
- Mack R, Mikhail B, Mikhail M. Wörterbuch der Veterinärmedizin und Biowissenschaften. 3. Aufl.. Berlin: Parey; 2001
- Schimke E. Methoden der Euthanasie. In: Grünbaum EG, Schimke E. Hrsg. Klinik der Hundekrankheiten. 3. Aufl.. Stuttgart: Enke; 2006
- Löscher W, Richter A. Hrsg. Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie für die Veterinärmedizin. 4. Aufl.. Stuttgart: Enke; 2016
- Löscher W, Richter A, Potschka H. Hrsg. Pharmakologie bei Haus- und Nutztieren. 9. Aufl.. Stuttgart: Enke; 2014
- Pentobarbital. Im Internet: https://www.vetidata.de Stand: Dezember 2017
- Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Presseerklärung vom 03.11.2010.