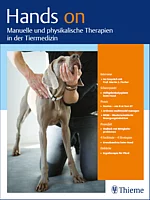Inhalt

Von Dämpfigkeit über COPD (chronic obstructive pulmonary disease) und COB (chronisch obstructive Bronchitis) bis hin zu RAO (recurrent airway obstruction) und IAD (inflammatory airway disease), das Equine Asthma ist unter vielen Namen bekannt. Sie alle meinen im Grunde dasselbe – eine chronische Verengung der Atemwege. Hiebei können die Behandlungsstrategien auf mehreren Säulen ruhen. Welche Möglichkeiten bei erkrankten Pferden in Betracht gezogen werden können, erklären 3 Fachleute anhand 3 verschiedener Strategien.
Pharmakologische Therapie der RAO und IAD
Dr.med. vet. Doris Börner erklärt, dass man bei Equinem Asthma zwischen einer hochgradigen und einer leichtgradigen Form unterscheidet.
Das hochgradige equine Asthma (RAO; recurrent airway obstruction) ist eine chronische, nicht infektiöse Atemwegserkrankung, die mit Leistungsminderung einher geht. Diese Erkrankung der unteren Atemwege ist durch wiederkehrende Episoden von Atemwegsobstruktionen gekennzeichnet, die durch eine Exposition mit Umweltantigenen entstehen.
Die betroffenen Pferde sind in der Regel älter als 7 Jahre. Klinisch zeigt sich eine Leistungsinsuffizienz, regelmäßiges bis häufiges Husten und eine erschwerte Atmung auch in Ruhe. Die Ausprägung dieser Anzeichen kann in Stärke und Dauer variieren. Nicht selten besteht die Erkrankung schon Wochen bis Monate vor der Diagnose. Die Erkrankung kann nicht geheilt werden, allerdings können die Symptome insbesondere durch eine Anpassung der Umgebung kontrolliert werden.
Eine Unterform des RAO ist die Sommerweiden-assoziierte obstruktive Lungenerkrankung (SPAOPD; summer pasture associated obstructive pulmonary disease), welche bei Weidepferden in den wärmeren Sommermonaten auftritt.
Das leichtgradige equine Asthma (IAD; Inflammatory Airway Disease) betrifft auch jüngere Pferde, wobei betroffene Pferde in der Regel keine Veränderung der Atmung in Ruhe zeigen.
Obstruktion der Atemwege
Beide Erkrankungen zeichnen sich durch exzessive Akkumulation von Schleim in den Atemwegen aus.
Die Diagnose basiert hauptsächlich auf den klinischen Zeichen, einer endoskopischen Untersuchung der Luftwege mit bronchoalveolären Lavage (BAL) und anschließender zytologischer Untersuchung, sowie dem Ausschluss von Differentialdiagnosen (z. B. Neoplasie, Virusinfektion, Lungenwürmer).
Grundlage der pharmakologischen Therapie sind die systemische Anwendung von Corticosteroiden (z. B. Dexamethason, Prednisolon), Bronchodilatatoren (z. B. Clenbuterol) sowie ergänzende Medikationen mit Interferon alpha oder mukoaktiven Substanzen (z. B. Acetylcystein, Dembrexin).
Bei der Behandlung wird zudem die Applikation der Medikamente als Aerosol (z. B. Corticosteroide, Bronchodilatatoren) mittels Verneblern eingesetzt.
Die Fütterung von Omega-3-Fettsäuren kann die Therapie außerdem unterstützen, da diese Entzündungsreaktionen modulieren.
Als Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie steht allen voran jedoch immer die Optimierung der Haltungsbedingungen.
Mit Physiotherapie Organfunktionen unterstützen
Auch mit Physiotherapie kann Pferden mit Equinem Asthma geholfen werden. Wie genau das funktioniert, erklärt Dr. med. vet. Andreas Zohmann, leitender Tierarzt des Vierbeiner Reha-Zentrums.
Das Pferd ist ein Vagotoniker und daraus erklärt sich die erhöhte Anfälligkeit, beispielsweise für Koliken oder auch Equines Asthma beziehungsweise COB oder COPD zu entwickeln. Das parasympathische Nervensystem bewirkt die Verengung der Bronchien sowie eine erhöhte Bronchialsekretion. Dies hat – chronisch geworden – zur Folge, dass das erkrankte Pferd mittels der Atemmuskulatur verstärkt versucht, das Ab- bzw. Ausatmen zu unterstützen.
Diese Erkrankung wurde noch bis vor nicht allzu langer Zeit als Dämpfigkeit des Pferdes bezeichnet. Eine der Symptomatiken ist die sich immer stärker entwickelnde Bauchatmung. Die Bauchmuskulatur wird unterstützend beim Ausatmungsprozess eingesetzt und das bei (fast) jeder Exspiration. Durch die Hypertrophie dieser Muskulatur (M. obliquus internus und externus abdominis) kommt es zur Ausbildung der sogenannten „Dampfrinne“. Darunter versteht man eine Muskelkante, verlaufend vom Xiphoid (Schwertfortsatz) nach schräg kaudodorsal, die dem Unterrand des M. obliquus abdominis entspricht.
Deshalb zielen physiotherapeutische Maßnahmen einerseits auf die Unterstützung der pulmonalen Organfunktion ab, andererseits seitens des Bewegungsapparates auf die Detonisierung der erreichbaren Hilfsexspiratoren (v. a. Bauch- und Interkostalmuskulatur).
Die Unterstützung der pulmonalen Organfunktion kann man durch ein rasches tonisierendes Tapotement (Klopfungen und Klatschungen) im Brustbereich erreichen. Das führt zur Anregung des Sympathikus und folglich zu Bronchienerweiterung und Sekretolyse.
Die Bauch- und Interkostalmuskulatur kann detonisierend mittels Petrissage (Kneten und Walken) und Friktionsmassage behandelt werden.
Was noch zum Einsatz kommen sollte:
- Interferenzstromregulationstherapie (IFR),
- Inhalationen mit verdünnten ätherischen Ölen sowie
- feuchtwarme Brustwickel als Formen der Hydrotherapie
Tradiotionell-chinesische Akupunktur – mit Nadeln gegen Asthma?!
„Aus Sicht der traditionell-chinesischen Akupunktur (TCA) fordert ein Erscheinungsbild, wie es die COPD (im Prinzip eines komplizierten Symptomenkomplexes) darstellt, eine völlig andere Herangehensweise als die westlich-wissenschaftliche praktizierte“, so Tierarzt Thomas Kreis.
Hierbei werden innere und äußere Faktoren, Lebensmuster, 8 Leitkriterien, Yin und Yang, das Innen-Außen, Fülle und Leere sowie Hitze und Kälte bedacht. Disharmonien werden bezüglich z. B. der Psychosomatik bzw. umgekehrt auch der Somatopsychik beleuchtet. Es gibt bestimmte psycho-somatisch (annähernd) einteilbare Typen, Umgebungsvariablen, Geschlecht (spielt eine sehr große Rolle), Alter, Ernährung, Organe (soweit beurteilbar) durch Sehen, Riechen und Palpation.
Erst aufgrund eines gesamtheitlichen „Ist“-Musters werden die TCM-gerichteten Akupunkturpunkte gewählt – explizit gemäß der soeben angeführten individuell ausgerichteten Befundung.
Individuell ausgerichtet
Genaue Kenntnis und Beherrschung der TCM-Diagnostik und Therapie sind hierfür Voraussetzung.
Aus westlich-wissenschaftlicher Sicht seien einige bewährte Punkte genannt:
- LU 01 (Anfangspunkt des Lungenmeridians)
- BL (Blasenmeridian) 13, 14, 15
- Herz-, Pericard- und Lunge. Das Herz spielt speziell auch wegen der Herzbelastung durch die Lungenproblematik eine Rolle.
- DI 10: Der Dickdarmmeridian (N. radialis) hat aufgrund der neuronalen Beziehung über den Plexus brachialis engen Bezug zum N. phrenicus: Innervation und Regulation des Zwerchfells!
Hervorgehoben sollte werden, dass der Bereich der Punkte BL 13–15 (Widerrist und dessen Umgebung) den segmentalen Bezug zu Lunge und Herz repräsentiert und auch in der Physikalischen Medizin – von der Massage bis zu Thermo- und Elektrotherapie – bei dieser Indikation vorteilhaft genutzt werden kann.
Der Originalartikel zum Nachlesen:
Börner D, Zohmann A, Kreis T. 3 Fachleute – 3 Strategien: Equines Asthma. Hands on - Manuelle und Physikalische Therapien in der Tiermedizin 2022; 4(01): 39 - 42. doi:10.1055/a-1685-0423
(JD)